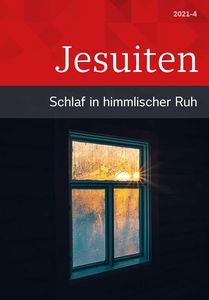Noch bevor mit Franz von Assisi die Krippendarstellungen aufgekommen sind, gab es im deutschsprachigen Raum das sogenannte Kindelwiegen. Dieser seit Mitte des 12. Jahrhunderts bezeugte Weihnachtsbrauch bestand in Andachten, bei denen ein Jesuskind aus Wachs o.ä. in einer Wiege sanft gewiegt und besungen wurde. Aus den dabei gesungenen Liedern entwickelten sich die geistlichen Wiegenlieder, die besonders im Alpenraum bis heute sehr beliebt sind. Zu den bekanntesten Liedern dieses Genres gehören „Es wird schon glei dumper“ (d.h. dunkel), „Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will“ oder eben das Lied im Titel dieses Beitrags. Das aus Tirol und Oberbayern stammende Lied „Still, o Himmel“ mag uns als Beispiel für die thematischen Aspekte dieser Zeugnisse der Volksfrömmigkeit dienen.
Die 1. Strophe gebietet Ruhe im Himmel und auf der Erde, denn „Jesus schließt die Äuglein zu“. Nun heißt es still sein, „dass nit zerstöret werde dessen angenehme Ruh“. Der Refrain lautet „Schlafe, Jesus, schlafe süß, und jetzt deine Ruh genieß“ und wird auf einer besonders weichen, wiegenden Melodie gesungen. Warum zieht der ruhige Schlaf dieses Kindes so viel Aufmerksamkeit und Andacht auf sich? Still werden. Ruhe finden und genießen. In der Stille Kraft schöpfen und diese Stille als heilige Ruhe schützen. Es ist eine Ruhe, die man nicht nur dem Jesuskind gönnen willen, sondern nach der sich die singenden und hart arbeitenden Menschen auch selbst sehnen. Die Wiege des Erlösers und sein entspanntes Gesichtchen schenken der eigenen Unruhe den ersehnten Frieden.
Für die geistlichen Wiegenlieder bedeutet die Wiege des Herrn dennoch kein Idyll. Bereits in der 2. Strophe heißt es: „Denke nit an Kreuz und Leiden, nit an jene Bitterkeit, / die dein Herz einst wird durchschneiden, es ist noch nit an der Zeit!“ Das Kind wird einst alle Ruhe und inneren Frieden für sein großes Werk der Versöhnung brauchen. Oder ist die Passion der eigentliche Grund für diese schützenswerte Ruhe vor dem Sturm? Die inhaltliche Tiefe geistlicher Wiegenlieder zeigt sich an der Zusammenschau von Wiege und Kreuz, wie wir sie auch in anderen Weihnachtsliedern finden, besonders ausgeprägt jedoch bei einem Text von Jochen Klepper (GL 254: „Dein Elend wendet keiner ab. / Vor deiner Krippe gähnt das Grab“).
Das schlafende Kind und seine Bestimmung rühren das Herz der Betrachtenden. In der 3. Strophe heißt es: „Da ich dich hier sehe liegen auf dem Stroh und harten Bett, / mache du mein Herz zur Wiegen, welches dir schon offen steht.“ Es ist die Bitte um ein weiches Herz für den Erlöser, der die Härte von Leiden und Tod für mich erduldet. Konsequent singt dann die 4. Strophe vom Segen der Auferstehung. Die Aufnahme des Herrn im Herzen bewirkt die Aufnahme des Betenden in das Reich Gottes.
Ob Volkslied oder Kunstlied wie z.B. „Mariä Wiegenlied“ von Max Reger (Text Martin Boelitz, 1912), die Intimität und Innigkeit der geistlichen Wiegenlieder bleiben selten ohne Wirkung. Rein menschlich betrachtet erfüllt der Anblick eines schlafenden Neugeborenen mit Liebe, Frieden und Verantwortungsgefühl. Er wirkt entwaffnend auf uns, die wir beruflich oft in mühsames Konkurrenzdenken verwickelt sind. Sein Anblick berührt, denn „nichts berührt wie das Unberührte“ (Österreichische Bundesforste). Gläubigen Menschen jedoch führt dieses schlafende Kind immer wieder das Staunenswerteste vor Augen: „Gott hat den Himmelssaal verlassen / und will reisen auf unseren Straßen“ (Still, still, still, 5. Strophe). Der Friede dieses Kindes erfülle uns und heile unsere Beziehungen.
Hans Brandl SJ