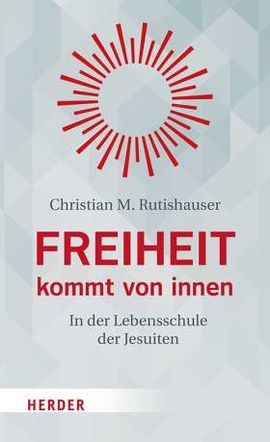-
Apollo and Daphne, Skulptur von Gian Lorenzo Bernini (1598- 1680)
-
Apollo and Daphne, Skulptur von Gian Lorenzo Bernini (1598- 1680)

Gier, Macht und Sexualität gestalten
"Freiheit kommt von innen", so hat P. Christian Rutishauser SJ sein neues Buch genannt. Darin beschreibt er die Lebensschule der Jesuiten als inneren Weg der Meditationspraxis und geistlichen Reflexion.
Zuweilen steht der Mensch vor gewichtigen Lebensentscheidungen, etwa Berufswahl oder Gestaltung der Lebensform. Die Möglichkeiten sind in der heutigen Gesellschaft so vielfältig, dass allgemeine Muster weggefallen. Zwar existieren noch gesellschaftliche und kirchliche Normen. Gerade im privaten Bereich ist ihre Deregulierung jedoch weit fortgeschritten. Sich bewusst entscheiden, als Single zu leben, Kinder zu adoptieren, eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft einzugehen, vieles ist möglich. Oft muss sich ein Mensch auch mit einer Lebenssituation anfreunden, die er nicht gewählt hat. Sich bewusst dafür zu entscheiden, wenn nicht anders möglich, ist von großer Wichtigkeit. Authentisches Leben entsteht nur, wenn innere Voraussetzungen mit äußeren Situationen in einen Dialog gebracht werden. Der Mensch kann nur wählen, was das Milieu, in dem er lebt, ihm auch als Möglichkeiten bietet. Damit sei nicht der Maxime das Wort gesprochen, jeder solle nach seiner eigenen Fasson selig werden. Es geht nicht um einen Individualismus. Vielmehr sollen Menschen den mühsamen Prozess, authentisch zu werden, auf sich nehmen. Nur wenn sie keine Nummern, Modelle von der Stange sind, können sie aus ganzem Herzen und mit voller Kraft über sich selbst hinauswachsen und die Gemeinschaft bereichern. Genau dazu braucht der Mensch aber auch eine geistige Tradition zur nachhaltigen Orientierung. Sie allein hebt ihn aus dem alltäglichen Überlebenskampf heraus, der ihn mit seinen Sorgen um materielle Absicherung und soziales Ansehen verschlingen würde.
Es mag erstaunen, doch ein Blick in die Geschichte der religiösen Orden und spirituellen Bewegungen ist dabei inspirierend. Immer schon haben Menschen besondere Lebensformen geschaffen, wenn sie mehr als den üblichen Kampf um das eigene Überleben suchten. In der Geschichte des Christentums sind zahlreiche soziale Formen entstanden: In der Spätantike bildete sich das Mönchstum heraus. Männer und auch Frauen haben sich der Gesellschaft entzogen und in Hausgemeinschaften und Klöstern eine Alternativkultur geschaffen. Über das Ideal der Jungfräulichkeit konnten sich gerade Frauen den patriarchalen Gesellschaftsstrukturen entziehen. Sie waren nicht mehr einem pater familias oder einem Bruder unterstellt. Nonnen und Mönche stellen bis heute eine archetypische Lebensform dar, die sich an einer geistigen Welt orientiert und sich von daher emanzipiert. Im Mittelalter entstanden breite Armutsbewegungen, um der aufkommenden Geldwirtschaft einen Lebensstil entgegenzusetzen, der sich mehr an solidarischen Beziehungen orientiert. Von losen Netzwerken, wie sie die Beginen darstellten, bis hin zu den Bettelorden, die sich der Bildung oder sozialen Hilfe verschrieben, sind unterschiedliche Gemeinschaftszusammenschlüsse entstanden. Eine spirituelle Glaubensüberzeugung und das Bewusstsein, der Gesellschaft einen geistlichen Dienst zu tun, hielt sie zusammen. In der Neuzeit sind schließlich die apostolischen Gemeinschaften entstanden. In ihrem Fokus steht ein konkreter Dienst an der Gesellschaft, zu dem sie sich vom Evangelium her motiviert fühlen: Unzählige Frauengemeinschaften haben sich für Kindererziehung, Frauenförderung oder Krankenpflege gebildet. Das Sozial-Diakonische, aus Gebet und Gottesdienst gespeist, hat Sinn gegeben. In jeder Epoche haben sich also spirituelle Lebensformen entwickelt, die auf spezifische Herausforderungen geantwortet haben. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts stehen wir wieder in einem fundamentalen gesellschaftlichen Umbruch. So erstaunt es nicht, dass sich nicht nur eine Fülle von individuellen Lebensentwürfen zeigt, sondern auch zahlreiche neue religiöse Bewegungen und spirituelle Netzwerke. Gerade seit den 1960ern und 1970ern wird mit religiösen Lebensformen experimentiert. Auch die digital und virtuell, global und interreligiös geprägte Gesellschaft wird ihre religiösen Lebensformen hervorbringen.
So unterschiedlich die religiös-alternative Lebensgestaltung in den verschiedenen Epochen auch ist, so haben sie doch gemeinsam, dass sie alle versuchen, der Grunddynamik der menschlichen Selbstbehauptung eine Form zu geben. Der Angst um sich selbst und der mimetischen Dynamik setzen sie drei Gelübde entgegen: Gehorsam, Armut und Keuschheit. Als Antwort auf das Begehren von Ansehen und Macht hatte sich das Gehorsamsgelübde ntwickelt, das zu einer hörenden Freiheit führen will. Wie sieht Machtgestaltung und Hören auf die Bedürfnisse der Mitmenschen und auf Gott in der Zukunft aus? Die Antwort auf die materielle Gier und das unmäßige Absichern durch materiellen Reichtum will das Armutsgelübde sein. Frohe Bescheidenheit soll frei machen. Wie sieht Selbstverzicht in einer begrenzten, globalisierten Welt aus, in der immer noch zu viele Menschen auf die Kosten anderer und der Natur leben? Und auf die unbändige Libido und Sexualkraft hatte die Tradition mit dem Keuschheitsgelübde geantwortet, sodass erlöste Liebe möglich wird. Was bedeutet es aber, in einer übersexualisierten und offenen Gesellschaft keusch zu leben? Hörende Freiheit, frohe Bescheidenheit und erlöste Liebe sind aber die drei Tugenden, die die Zukunft nötig hat. Es wird neue soziale und institutionelle Rahmenbedingungen brauchen, um sie zu fördern und zu stützen.
Wahre Freiheit kommt von innen
Wie gewinnt der Mensch wirkliche, innere Freiheit? Auf den Spuren seines Ordensgründers Ignatius von Loyola bahnt Christian Rutishauser den Weg von der Oberfläche hin zu einem Leben, das in sich selbst ruht und darum frei ist. Dem Rhythmus ignatianischer Exerzitien entlang führt der langjährige Chef der Schweizer Jesuiten seine Leser ins Innere, in die Gegenwart Gottes im Leben, zu sich selbst. Eine faszinierende Reise mit Abgründen, Hindernissen – und einem Ziel, das jede Anstrengung lohnt.

Autor:
Pater Christian Rutishauser SJ ist der Delegat für Hochschulen der Zentraleuropäischen Provinz der Jesuiten. Bis zur Gründung der neuen Provinz war er Provinzial der Schweizer Provinz. 1965 geboren und in St. Gallen aufgewachsen. Studium der Theologie in Fribourg und Lyon. Ein Jahr Pfarreiarbeit und anschliessend Noviziat der Jesuiten in Innsbruck. 1994-1998 Arbeit als Studentenseelsorger an der Universität Bern und Leiter des Akademikerhauses in Bern. Doktoratsstudium im Bereich Judaistik in Jerusalem, New York und Luzern. Dissertation zu Rav Josef Dov Soloveitchik (1903-1990) mit dem Titel «Halachische Existenz» im Mai 2002. Seither verschiedene Lehraufträge im Bereich jüdischer Studien, so an der Hochschule für Philosophie S.J. in München, am Kardinal-Bea-Institut an der Universität Gregoriana in Rom und am Theologischen Studienjahr an der Dormitio-Abtei in Jerusalem. Seit 2004 Mitglied der Jüdisch/Röm.-kath. Gesprächskommission der Schweizerischen und seit 2012 auch der Deutschen Bischofskonferenz. Delegationsmitglied der vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen mit dem Judentum seit 2004; seit 2014 in derselben Funktion ständiger Berater des Heiligen Stuhls.
Wissenswertes
Spiritualität ist „ein Weg zu Gott“, niemals abstrakt, sondern sie wird lebendig in jedem Menschen. Ignatianische Spiritualität bezieht sich auf die „Geistlichen Übungen“ (Exerzitien), mit denen der Hl. Ignatius von Loyola Menschen helfen wollte, Gott zu finden und ihr Leben auf Gott auszurichten. Er war überzeugt davon, dass Gott selbst in jedem Menschen wirkt und ihn in die Freiheit führen will, damit er verantwortet wählen und entscheiden kann. Ignatianische Spiritualität ist eine Spiritualität der Freiheit, der Unterscheidung und Entscheidung, und das Grundprinzip ist das Wachsen und Lernen. Sie ist eine Spiritualität der Dankbarkeit. Ignatius erlebte sich bei aller Gebrochenheit zutiefst als beschenkt, geliebt von Gott und durch Jesus Christus erlöst. Auf diese Erfahrung wollte Ignatius mit seinem Leben großherzig antworten und anderen dabei helfen, Gott in allen Dingen zu suchen und finden. Ignatianische Spiritualität ist eine Mystik des Dienstes. Die „Geistlichen Übungen“ wollen einen „Menschen für andere“ formen, wie es dem Lebensmodell Jesu entspricht.
Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:
×